29. Januar 2025 | News | Aktuelle Veröffentlichungen
Winter 2024/25
Lesen Sie hier, welche aktuellen Publikationen im Winter 2024/2025 veröffentlicht wurden.
Alle Publikationen des MPIDR
Heim nach dem Brexit: Belege für die Migration von Forschenden aus bibliometrischen Daten
Artikel veröffentlicht 1. Dezember 2024
Studie untersucht die ersten Auswirkungen des Brexit-Referendums von 2016 auf die Mobilität von Forscher*innen nach und aus Großbritannien

© istockphoto.com/egal
Das Forscherteam nutzt bibliometrische Daten aus Millionen von Einträgen in der Publikationsdatenbank Scopus, um Umzüge von Wissenschaftler*innen aus Veränderungen ihrer Affiliation abzuleiten. Das Team konzentriert sich auf eine ausgewählte Stichprobe international mobiler Wissenschaftler*innen, deren Umzüge anhand ihrer Publikationen für jedes Jahr zwischen 2013 und 2019 nachvollziehbar sind, und misst die Veränderungen in ihren Migrationsmustern.
Obwohl das Team nach dem Brexit-Referendum keinen Brain Drain beobachtet, finden es Hinweise darauf, dass sich die Mobilitätsmuster der Wissenschaftler*innen geändert haben. Bei den aktiven und international mobilen Wissenschaftler*innen stieg die Wahrscheinlichkeit, das Vereinigte Königreich zu verlassen, um etwa 86 Prozent, wenn ihr akademisches Herkunftsland (Land, in dem sie ihre erste wissenschaftliche Studie veröffentlicht haben) ein EU-Land war. Für Wissenschaftler*innen mit akademischer Herkunft aus dem Vereinigten Königreich sank die Wahrscheinlichkeit, das Vereinigte Königreich nach dem Brexit-Referendum zu verlassen, um etwa 14 Prozent, und die Wahrscheinlichkeit, (wieder) ins Vereinigte Königreich zu ziehen, stieg um etwa 65 Prozent. Die Analyse deutet darauf hin, dass sich die Vielfalt der akademischen Herkunftsländer der Wissenschaftler*innen, die in das Vereinigte Königreich einreisen und es verlassen, nach dem Brexit verändert hat.
Originalpublikation
Sanlitürk, E., Aref, S., Zagheni, E., Billari, F. C.: Homecoming After Brexit: Evidence on Academic Migration from Bibliometric Data. Demography (2024). DOI: doi.org/10.1215/00703370-11679804
Keywords
Bibliographische Daten, Migration, Brexit, Forschende
Fertilitätstrends in den Industrieländern neu denken
Artikel veröffentlicht 1. Dezember 2024
Studie untersucht den Zusammenhang von gesellschaftlicher Entwicklung und Fertilität
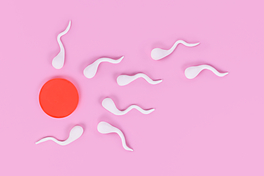
© istockphoto.com / Firn
Die Geburtenraten in den Industrieländern sind weltweit rückläufig, ein Trend, der oft mit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung in Verbindung gebracht wird. Eine Studie unter der Leitung von Henrik-Alexander Schubert vom MPIDR zeigt, dass die Geburtenraten tatsächlich steigen können, wenn die gesellschaftliche Entwicklung ein hohes Niveau erreicht hat, ein Muster, das als „J-Form“ bekannt ist. Dieser Zusammenhang scheint sich jedoch nach 2010 verschoben zu haben, möglicherweise beeinflusst durch die Wirtschaftskrise 2007/08 und den Wandel gesellschaftlicher Werte.
Die vollständige Meldung lesen Sie hier.
Original Publikation
Henrik-Alexander Schubert; Christian Dudel; Marina Kolobova; Mikko Myrskylä: Revisiting the J-Shape: Human Development and Fertility in the United States in Demography (2024). DOI: 10.1215/00703370-11680156
Keywords
Fertilität, Geburtenrückgang, menschliche Entwicklung, subnationale Forschung, gesellschaftliche Entwicklung
Bildungsniveau sagt Geburtenentwicklung in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften voraus
Artikel veröffentlicht am 1. Dezember 2024
Studie: Zunehmende Fertilität bei Frauenpaaren in Finnland

© istockphoto.com / bernardbodo
Eine neue Studie der Universität Helsinki und des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPIDR) hat die Fertilitätstrends bei gleichgeschlechtlichen Frauenpaaren in Finnland untersucht. Die Daten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von fünf Jahren ein Kind zu bekommen, bei Paaren, die ihre Partnerschaft zwischen 2002 und 2016 eintragen ließen, deutlich gestiegen ist: von 20 % auf 45 %. Dieser Trend war bei Paaren mit höherem Bildungsniveau besonders ausgeprägt, während die Wahrscheinlichkeit bei Paaren mit niedrigerem Bildungsniveau abnahm. Trotz der Unterstützung durch die finnische Gesetzgebung gibt es nach wie vor große Unterschiede beim Zugang zur Elternschaft. Damit wird die Notwendigkeit unterstrichen, die verbleibenden Hindernisse für die Geburt von Kindern zu beseitigen, insbesondere vor dem Hintergrund sinkender Geburtenraten.
Die vollständige Meldung lesen Sie hier.
Original Publication
Maria Ponkilainen, Elina Einiö, Marjut Pietiläinen, Mikko Myrskylä: Educational Differences in Fertility Among Female Same-Sex Couples in Demography (2024), DOI: 10.1215/00703370-11687583
Keywords
Gleichgeschlechtliche Paare, Eingetragene Partnerschaft, Familiengründung, Kinderkriegen, Bildungsniveau
Bildung von Frauen beeinflusst die Fertilität in Subsahara-Afrika
Artikel veröffentlicht am 4. November 2024

© istockphoto.com / PixelCatchers
Neue Forschungsergebnisse zeigen einen starken Zusammenhang zwischen einem höheren Bildungsniveau von Frauen und einer niedrigeren Geburtenrate in Subsahara-Afrika. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPIDR) und seiner Partner kommt zu dem Ergebnis, dass gebildete Frauen den Wandel hin zu kleineren Familien anführen und sogar die Entscheidungen weniger gebildeter Frauen in ihrem Umfeld beeinflussen. Das innovative bildungsbasierte Prognosemodell der Studie gibt politischen Entscheidungsträgern bessere Instrumente an die Hand, um zu verstehen, wie die Bildung von Frauen zukünftige demografische Trends beeinflussen und eine nachhaltige Entwicklung fördern kann.
Die vollständige Pressemitteilung lesen Sie hier.
Originalpublikation
Adhikari, S., Kebede, E., Lutz, W.: Forecasting Africa's Fertility Decline by Female Education Groups in PNAS (2024); DOI: 10.1073/pnas.2320247121
Keywords
Prognosen, Kohortenfertilität, Afrika, Bildung von Frauen, Fähigkeiten, Frauenbildung
Die Familie als Vermögensfaktor
Artikel veröffentlicht am 19. Oktober 2024
Studie zeigt, wie Generationenwechsel und Familienereignisse mit dem Wohlstand einer Person zusammenhängen

© istockphoto.com / Drazen Zigic
Eine neue Studie des Max-Planck-Institutes für demografische Forschung, der Universität zu Köln, der GESIS und des Norwegian Institute of Public Health hat untersucht, wie sich der finanzielle Wohlstand von Individuen in Abhängigkeit von verschiedenen familiären Generationenwechseln verändert. Es zeigt sich, dass Menschen, die spät Eltern und Großeltern werden und darüber hinaus spät ihre Eltern verlieren, ihr Vermögen am stärksten steigern können, während Vier-Generationen-Familien die geringsten Vermögenszuwächse verzeichnen. Der finanzielle Wohlstand einer Person hängt vom Zusammenspiel mehrerer familiärer Ereignisse ab und ist immer mit der Familie als Ganzes verbunden.
Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung.
Originalpublikation
Bettina Hünteler, Theresa Nutz, Jonathan Wörn: The relationship of intergenerational family transitions and wealth in Norway: A life course perspective in Oxford University Press (2024). DOI: 10.1093/sf/soae151
Keywords
Norwegen, Familiendemografie, Ungleichheit, Bevölkerungsregister, Wohlstand
Review weist auf doppelte Diskriminierung von Migrantinnen hin
Artikel veröffentlicht am 10. Oktober 2024
Ein Blick auf Geschlechtsspezifische Unterschiede im Migrationsprozess

© iStockphoto.com / LenLis
Forscher*innen des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPIDR) und des Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, in der sie die Ergebnisse von 170 Studien zu geschlechtsspezifischen Unterschieden im Migrationsprozess auf der Grundlage quantitativer Forschung und verschiedener Migrationsdatenquellen zusammenfassen und analysieren. Die Studie zeigt, dass Frauen nicht so häufig wie Männer ihre Migrationsziele erreichen. Zudem rücken Forschungsergebnisse die gängige Erzählung von der "Feminisierung der Migration" in ein neues Licht und lassen auf eine doppelte Diskriminierung von Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt schließen. Sie werden diskriminiert, weil sie Frauen sind und weil sie den Migrantinnenstatus haben. Es wird hervorgehoben, dass die meisten bisherigen Studien sich hauptsächlich mit dem Globalen Norden beschäftigen und die Migrationsmuster im und in den globalen Süden bislang nicht ausreichend erforscht sind. Die Forscher*innen betonen wie wichtig es sei, geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Migration für demografische Vorhersagen zu berücksichtigen.
Autorin Athina Anastasiadou vom MPIDR erklärt: "Der wichtigste Beitrag unserer Arbeit liegt darin, die Forschung zu beleuchten, die sich bereits mit dem Verständnis des Zusammenhangs zwischen Geschlecht und Migration befasst hat. Gleichzeitig wollen wir eine verbesserte Datenerhebung nach Geschlecht fordern und Demograf*innen dazu ermutigen, ihr Konzept von „Geschlecht“ zu überdenken, wenn sie Migration als eine Komponente des demografischen Wandels untersuchen, die nicht durch biologische Merkmale, sondern durch gesellschaftliche Normen und Rollen bestimmt wird.
Originalpublikation
Athina Anastasiadou, Jisu Kim, Ebru Sanlitürk, Helga A. G. de Valk, Emilio Zagheni: Gender Differences in the Migration Process: A Narrative Literature Review in Population and Development Review (2024), DOI: 10.1111/padr.12677
Keywords
migration, gender, sex, literature review